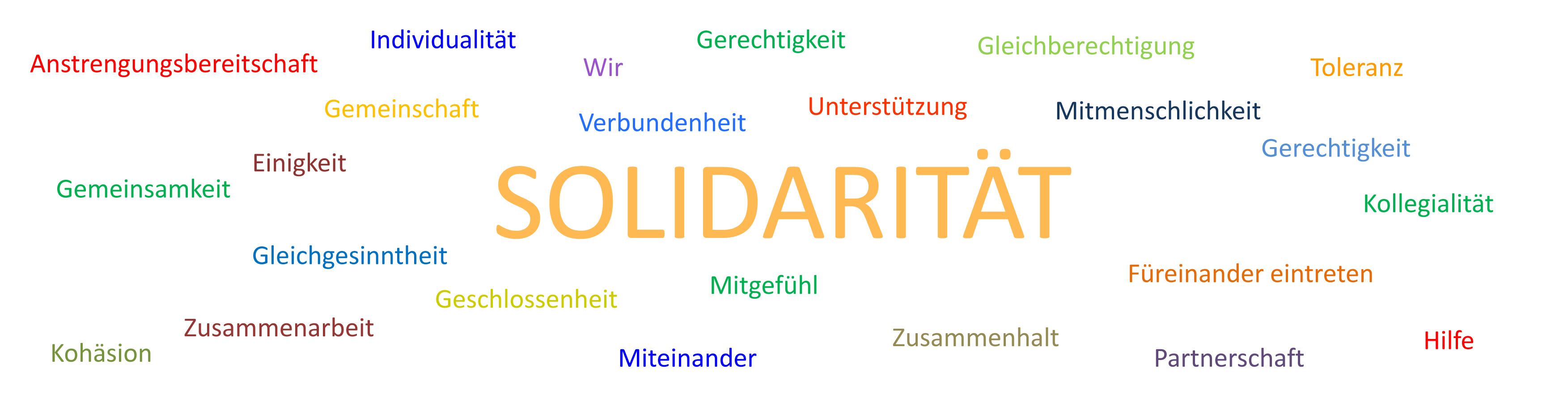“Bei Frühe Hilfen handelt es sich um ein Maßnahmenpaket, das darauf abzielt, gesundheitliche Belastungen von Familien und Kindern frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig gegenzusteuern.
Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser zum Nutzen von Frühen Hilfen: “Präventionsmaßnahmen in der frühen Kindheit sind besonders effizient. Sie wirken sich langfristig positiv auf die Gesundheit aus und sind ein wirksamer Beitrag zur gesundheitlichen Chancengerechtigkeit, zur Armutsbekämpfung und zur Senkung späterer gesundheitlicher Risiken. Auch der ökonomische Nutzen ist nachweislich bei Maßnahmen in der frühen Kindheit am größten.”
Im Mittelpunkt stehen FamilienbegleiterInnen, die als konkrete Ansprechpersonen für die Familien da sind. Als freiwilliges Angebot helfen sie den Betroffenen, geeignete soziale und gesundheitsbezogene Angebote zu finden und in Anspruch zu nehmen. Die FamilienbegleiterInnen arbeiten in sogenannten Frühe-Hilfen-Netzwerken, die sich um eine optimale Vernetzung und Weiterentwicklung dieser Angebote bemühen. Dieses Netzwerk besteht aus unterschiedlichsten Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesen und der Kinder- und Jugendhilfe (z.B. Krankenanstalten, Krabbelstuben, Schuldnerberatung, Eltern-Kind-Zentren, Mutterberatungszentren, praktische Ärzte oder Fachärzte), die einerseits als ZuweiserInnen zu den Frühen Hilfen agieren, andererseits mit ihren Leistungen auch als KooperationspartnerInnen zur Verfügung stehen.”(bmg)
nähere Infos unter:
BM für Gesundheit
Frühe Hilfen